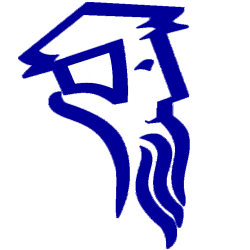Wir spüren eindringlich die Auswirkungen eines sich längst vollziehenden Wandels mit: Traditionsabbruch, Desinteresse am Kirchenjahr, an regelmäßigen Sonntagsgottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen, Nichtgebrauch von Taufe, Konfirmation, Hochzeit und sogar Beerdigungen bis hin zu Austritten. Andererseits gibt es auch positive Erfahrungen mit engagierten Mitarbeitenden, stabilen Gemeindegruppen, großem Interesse an Übergangsriten im Kindergarten und der Schule, eine Bereitschaft für konkrete Projekte zu spenden …
Als Kirchengemeinde geht es gerade jetzt darum, eine mittel- und langfristige Strategie zu entwickeln und zu verfolgen, wenn wir aktuell Entscheidungen treffen.

Bislang standen die Überlegungen in vielen Gemeinden zumeist unter der Direktive, traditionelle Angebote auf jeden Fall zu bewahren und Neues höchstens hinzuzufügen. Das hat zumindest einen guten Grund. Da niemand die Zukunft vorhersagen kann oder verlässlich abschätzen kann, wie sich entscheidende Veränderungen mittelfristig auswirken, scheint das Gewohnte das einzig Sichere.
Schon unser menschliches Gehirn ist auf das Festhalten an Gewohnheiten konditioniert. Unter dem spürbaren Bedeutungsverlust von Kirche scheinen Veränderungen sogar gefährlich. In der Krise ist die Verlockung sehr groß, wieder zum Alten zurückkehren zu können.
Das ist nicht neu, aber schon immer ein Trugschluss. Die Bibel erzählt vom verklärenden Rückblick der Israeliten auf die „Fleischtöpfe Ägyptens“ während des mühsamen Weges in die Freiheit. Die Propheten, Jesus Christus, die Reformation und auch die Zeit des Kirchenkampfes lehren uns, dass Gott in Umbrüchen Heilsgeschichte schreibt. Gott will nicht im Museum verehrt, sondern in den gegenwärtigen Umständen wirksam werden. Und schon für Abraham verknüpft Gott seine Verheißung auf eine gesegnete Zukunft mit dem Aufruf: „Geh heraus in ein Land, dass ich dir zeigen werde.“
Folgen wir dieser Verheißung, können wir unseren Weg auch als Kirchengemeinde bewusst gehen, statt uns treiben zu lassen. Ein Wegweiser kann unser Auftrag sein:
Die Barmer Theologische Erklärung formuliert ihn in der 6ten These so: Es ist unsere Aufgabe als Kirche, die Botschaft von der freien Gnade Gottes zu verkünden an alles Volk.
Diese Rückbesinnung auf den Missionsbefehl aus Matthäus 28, dass wir zu allen Menschen gesandt sind, bedeutet nicht dass alle Menschen Kirchenmitglieder werden oder bleiben sollen. Sie verwehrt sich gegen eine schulterzuckende Gleichgültigkeit, wenn wir aus Desinteresse oder Abwehr Menschen übersehen, ignorieren oder ausschließen.
Aber genau das geschieht, wenn wir aus der Überzeugung heraus eine Gemeinde für alle zu sein, tatsächlich nur Gemeinde für die sind, die Kirche gut finden, so wie sie sie von früher kennen.
In einer sich immer weiter differenzierenden Gesellschaft schließen wir immer mehr Menschen aktiv aus durch die Selbstgenügsamkeit, mit der wir auf unsere traditionellen Angebote und Formen beharren. Von der Sitzordnung bis zur Musik, von der Sprache bis zu den Ritualen wird das, was uns einst als Volkskirche verbunden hat, immer mehr zur Ab- und Ausgrenzung.
Das Pfingstwunder in der Apostelgeschichte betraf zuerst die Jünger selbst, die sich durch die Kraft der Begeisterung aus dem Haus heraus trauten und die Sprache der Völker um sie herum sprachen. Die Verbindung entstand nicht dadurch, dass die Völker eine Einheitssprache lernten, sondern die Jünger die großen Taten Gottes in vielfältiger Weise ausdrücken konnten. Warum sollten wir also in unseren Kirchengemeindestrukturen hocken bleiben und warten, dass die Menschen endlich wieder die volkskirchliche (Formen-)Sprache der vergangenen Jahrhunderte sprechen?
Als Kirchengemeinde werden wir unserem Auftrag gerecht, wenn wir uns herauswagen und auf den Weg machen zu den Menschen.
Dabei möchte ich zwei Unterscheidungen beachten.
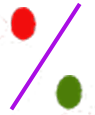
Die erste Unterscheidung betrifft die persönliche Frömmigkeit und die institutionalisierte Frömmigkeit als Kirchengemeinde.
Die persönliche Frömmigkeit ist eine höchst individuelle Angelegenheit zwischen jedem einzelnen Menschen und Gott selbst. Als Kirchengemeinde sollen wir sie fördern, ohne sie zu normieren und reglementieren.
Zugleich ist die Gemeinschaft mit anderen ein menschliches Grundbedürfnis und steht unter der Verheißung Jesu: Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen kommen, bin ich mitten unter ihnen.
Es ist also naheliegend, uns in Kirchengemeinden zu organisieren. Und es ist auch legitim, Kirchengemeinden so zu organisieren, dass sie ihrem Auftrag gerecht werden können, Menschen erreichen, begleiten und Glaube teilen zu können.
In unserer Gesellschaft nimmt das Bedürfnis nach institutionalisierter Gemeinschaft rapide ab. Das ist nicht falsch oder unchristlich. Es stellt uns zunächst nur als Institution in Frage. Dann aber ist es auch angemessen als Institution zu fragen, wie wir unsere Institution stärken und erhalten können. Nicht als Selbstzweck, sondern um unseren Auftrag zu erfüllen.
Und wir dürfen auch darüber sprechen, dass manche Kritik an Kirche als Institution nicht auf die Freiheit der Mitglieder zielt, sondern von dem Interesse geleitet wird, sie an konkurrierende Werte abzuwerben.
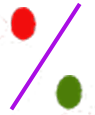
Die zweite Unterscheidung betrifft die konkreten Bedürfnisse von Christen an die Kirche und die Meinung, dass es die Institution Kirche geben soll.
Es gibt einen Wunsch von Kirchenmitgliedern, dass es Kirche und Gottesdienste, diakonisches Engagement und Gemeindeveranstaltungen geben soll – obwohl man sie selbst gar nicht in Anspruch nehmen möchte. Die Mitgliedschaft ist dabei nicht gedeckt von konkreten Bedürfnissen an die Institution, wohl aber an Vorstellungen wie diese Kirche sein soll – nämlich so, wie man sie nicht braucht. Fortschreitend unterhöhlt dieser Mangel konkreter Bedürfnisse an die Institution die Verbindung zur Kirche. Und ohne konkrete Erfahrungen der Bedeutsamkeit von Kirche (ver)schwindet die Vorstellung, dass Kirche eine Bedeutung hat.
Das hat fatale Auswirkungen. Wenn es kaum konkrete Bedürfnisse nach Kirche gibt, kann eine Kirchengemeinde sie auch nicht erfüllen. Und wenn der vorherrschende Wunsch sich in dem puren Bestehen und der Beständigkeit erschöpft, besteht kaum ein Anlass, sich als Kirche zu wandeln. Da genau das aber zum Bedeutungsverlust der Institution führt, ist der Teufelskreis geschlossen.
Gibt es einen Ausweg? Ich glaube, ja.
Mir hat die Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Lösungen bei Marshall Rosenberg sehr zur inneren Klärung geholfen. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen:
Menschen essen erschreckend oft Fastfood. Das Bedürfnis eines Menschen vor der Fastfoodkette kann dabei Hunger, bezahlbares Essen, Kontakt, Zugehörigkeit … sein. Die Lösung kann sein: Ich kaufe einen Burger. Als Kirche neigen wir dazu, dieses Begehren nach Fastfood zu kritisieren mit Hinweis auf ethische Bedenken gegen Hersteller und Verbraucher. Oder wir preisen unsere kirchliche Speisekarte für den Hunger der Seele an. Konkreter wäre es, zum gemeinsamen Kochen einzuladen oder eine Gruppe zu bilden, die gesunde „burger to go“ im kirchlichen Kindergarten anbietet.
Statt Lösungsstrategien einer ethischen Bewertung zu unterziehen, ist es förderlicher den zugrundeliegenden Bedürfnissen nachzuspüren und attraktive Lösungen für die Probleme von Menschen anzubieten. In der Wirtschaft wird in diesem Fall von Kundenorientierung gesprochen.
Auf den ersten Blick scheint eine „Kundenorientierung“ dem innersten Kern der Kirche zu widersprechen, da wir uns als Kirche ja an Gott orientieren wollen und nicht am Menschen. Auf den zweiten Blick gibt es diesen Widerspruch nicht. Der etwas kecke Spruch „Mach‘s wie Gott, werde Mensch“ erinnert daran, dass Gott selbst dezidiert menschenorientiert ist. Menschliche Bedürfnisse sind nicht schlecht. Unmenschlich zu sein ist nicht positiv. Die Aufgabe für uns als Kirchengemeinde besteht darin, hinter den menschlichen Verhaltensmustern die Bedürfnisse zu erkennen und auf diese Bedürfnisse mit lebensfördernden Lösungsangeboten einzugehen. Zumindest wenn sie in den Kompetenzbereich der Kirche fallen und insbesondere wenn sie die Verbindung zur Institution stärken.

Es wäre ein zukunftsweisender Schritt, unsere kirchlichen Angebote darauf hin zu prüfen, ob sie Menschen stärken, zum Lachen bringen, sättigen, ernst nehmen, aufrichten, trösten, ermutigen und ermündigen, erfrischen, befreien, wärmen … Das hieße ja den Weg Gottes in Jesus Christus hinein in diese Welt nachzugehen. Das hieße aber auch aufzuhören mit Angeboten, die abhängig oder träge machen, ermüden oder entmündigen, vertrösten oder abwiegeln …
Das klingt einfacher, als es in der Umsetzung ist. Ich bemühe noch einmal den Vergleich: Fastfood ist durchaus kundenorientiert, wie der Erfolg entsprechender Ketten belegt. Im Erfolg von Fastfoodketten spiegeln sich auch nicht „falsche“ Bedürfnisse von Menschen – in der Kirchensprache sagen wir weltlich oder sündig. Das Problem an Fastfood ist der Mangel an Phantasie und Hingabe, um preiswertes, gewürztes, schnelles Essen mit guten Lebensmitteln und unter fairen Arbeitsbedingungen anzubieten. Dass es sehr wohl geht, zeigen einige eigentümerinnengeführte Suppenküchen und kleine Mittagstischrestaurants.
Kirche muss kein geistliches Fastfood anbieten und auch keine Gasthäuser erhalten, die in den fünfziger Jahren mal den Geschmack der Zeit trafen. Kirche kann die Nische suchen, die Qualität und Geschmack so vereint, dass Menschen gerne essen gehen.
Zurück aus dem Vergleich in die konkrete Frage, wie wir als Kirche auf dem Weg, heute die richtigen Entscheidungen für morgen treffen können. In komplexen Situationen gibt es keine Universallösung, aber zumindest gute Strategien. Einen Ansatz sehe ich darin:
Kirche sein, die lebensfördernde Bedürfnisse stillt, ohne jemanden strukturell oder kulturell auszuschließen.

Das ist kein neuer Ansatz und die Methoden sind es auch nicht. Aber unter dem Brennglas von Corona sind wir vielleicht bereiter den notwendigen Wandel als Gemeinde anzugehen.
Das muss kein radikaler Kurswechsel sein. Aber auch ein sanfter Wechsel muss begangen und kontinuierlich weiterverfolgt werden. Acht Wegmarken möchte ich aufgreifen:
- Teamarbeit scheint mir die Grundvoraussetzung einer zukunftsorientierten Gemeinde. Das Team bringt die Vielfalt der Gesichtspunkte, die Kommunikation, das Erleben der Gemeinschaft schon in die Planung und Umsetzung ein.
Theoretisch ist das in unsere evangelischen Strukturen implementiert. An der Umsetzung können wir noch »üben. Aufgaben, die nur von einem verantwortet und durchgeführt werden oder werden können, können wir ab sofort lassen. - Kontinuierlich Menschen im Umfeld der Gemeinde beachten und befragen, um ihre Bedürfnisse zu kennen. Wir müssen uns nicht an Idealen oder Wünschen orientieren, wie Kirche sein sollte. Wir fragen: Welche Herausforderungen stellt dir das Leben, und wie können wir sie als Kirche gemeinsam lösen?
- Bedürfnisorientierte Angebote machen und bewerben.
Da unsere Ressourcen absehbar knapper werden, ist eine Konzentration notwendig. Angebote, für die es keine Bedürfnisse gibt, dürfen wegfallen. Bleibende und neue Angebote werden so beworben, dass wir nicht nur beschreiben, was wir tun, sondern auch wofür es gut ist. (In diesem Gottesdienst kommst du zur Ruhe. Hier werden wir dich inspirieren. …) - Keine Angst vor der Nische.
Natürlich darf Kirche Mehrheiten repräsentieren oder Marktführer sein, muss aber nicht. Ein Angebot muss auch nicht für alle passen, sondern passen. In einer Nische ist Raum für Innovation, Gründergeist und auch für eine belangvolle Verbindung zwischen Mitgliedern und der Institution. - Frequenz vs. Nachhaltigkeit.
Es gibt eine lange Tradition abfälliger Betrachtung sogenannter „Weihnachtschristen“. Die Kritik wird zwar leiser, aber es wird immer noch als schmerzlicher Stachel in der Kirche empfunden, wenn der sonntägliche Gottesdienst nur von Wenigen gebraucht und genutzt wird. Die Relevanz eines Angebotes kann sich in der Häufigkeit der Teilnahme äußern, aber auch in der Nachhaltigkeit seiner Wirkung. Da ist gar keine Konkurrenz. Es braucht nur einen bewussten Umgang. Für die Institution braucht es eine Balance zwischen Aufwand und Wirkung. Das wöchentliche Angebot muss einfach im Aufwand sein, das Highlight im Jahr soll besonders nachhaltig sein und braucht deshalb aufwändige Vor- und Nachbereitung. Man kann nur nicht beides zugleich haben. Wir sollten uns weder den hohen Aufwand für jeden Sonntag, noch die beiläufige Behandlung außergewöhnlicher Ereignisse leisten. - Lokal vs. digital.
Lange Zeit waren lokale Angebote die einzig erreichbaren für die Mehrheit. Gottes Geist hat diese Grenzen schon immer überwunden. Symbole sind schon in sich selbst medial. Wenn wir an die Gegenwart Jesu glauben, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, hängt diese Gegenwart gerade nicht an der lokalen Präsenz.
Digitale Kirche nutzt nicht nur neue Kommunikationswege und neue Möglichkeiten eine Gemeinschaft zu bilden, sondern ist eine eigenständige Ausdrucksform der Kirche.
Wieder geht es nicht um Konkurrenz und nicht darum lokale Kirchenstrukturen digital zu kopieren oder zu ersetzen, sondern Kirche neu zu denken und zu erweitern. Also z.B. nicht nur lokale Gottesdienst abzufilmen, sondern eigene Formate zu entwickeln. - Lust am Tun.
Angesichts der Größe der Herausforderung droht uns an vielen Stellen die Überforderung und Erschöpfung. Salz soll würzen, Licht soll leuchten. Aber ohne die Qualität der Freude, wird aus Anstrengung Strenge und Begeisterung wird zum Fanatismus. - Versuch macht klug.
Hinterher wissen es alle besser. Aber wer meint, es schon immer gewusst zu haben, lernt nichts dazu. Immerhin war auch Jesus bereit umzudenken. Und aus Sackgassen gibt es einfache Auswege – die Umkehr. Ich wünsche uns als Kirchengemeinde immer wieder den Mut, etwas zu versuchen, und Misserfolge als Lernfelder zu behandeln.

Ein Anfang könnte sein, unsere bestehenden Angebote wie Gottesdienste und Gemeindegruppen, Kontaktstellen und Kommunikationsmittel, sowie unsere Organisationsstrukturen auf die Relevanz für die Menschen im Umfeld unserer Gemeinden zu untersuchen.
Ein zweiter Schritt wäre es, nicht relevante Veranstaltungen und Gewohnheiten einzuschränken und durch bedürfnisorientierte Angebote und Strukturen zu ersetzen. Indem die Institution mehr Agilität fördert und kleine Teams unterstützt, die bedürfnisorientierte Angebote entwickeln und anpassen.
Ich habe drei Formulare vorbereitet, um unsere Gemeindearbeit und die Menschen im Umfeld unserer Gemeinde zu betrachten, analysieren und Veränderungen zu planen.
Im Vertrauen auf Gottes Zusage:
„Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst;
ich will dich mit meinen Augen leiten.“ [Psalm 32,8]
6. Juni 2020, Fred Niemeyer
PS: Über eure Meinung und konstruktive Kritik würde ich mich sehr freuen.
Und was ist nun spezifisch an Kirche? – Sie glauben!
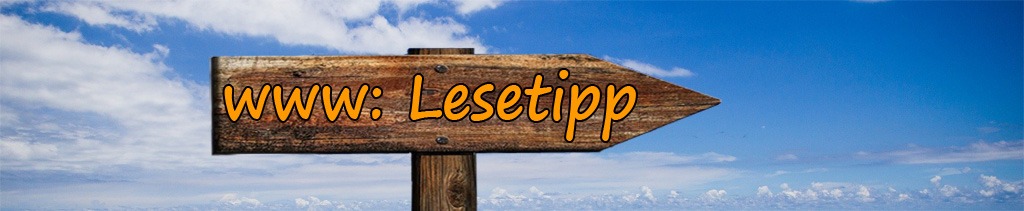
Weitere Lesetipps zum Thema:
Der Artikel von Pastorin Carola Scherf erzählt anschaulich und persönlich den Hintergrund von einem eindrücklichen Zitat: „Wir wollen von euch was hören, was auch wirklich Substanz hat”.
Einen differenzierten Blick auf die aktuelle Lage der Kirche beschreibt die Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt aus der Nordkirche. “Für uns als zukünftige Kirche wird zentral sein: zuhören, sich aus Gewohntem herausbewegen, Hoffnung teilen, da sein für Menschen in Glück und in Not”.
Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung: “midi ist eine Zukunftswerkstatt, die frische Ideen mit Vernetzung und praktischer Hilfe verbindet. Sie steht für das Entwickeln, Probieren, Scheitern, Lernen und Gelingen im Weitergeben der Guten Nachricht.”